Aktenführung, Archivierung und Erinnerung in stationären Hilfen aus Adressat*innenperspektive
Sie können diese Ausgabe im Online-Shop unseres Partners beziehen.
Zum Online-Shop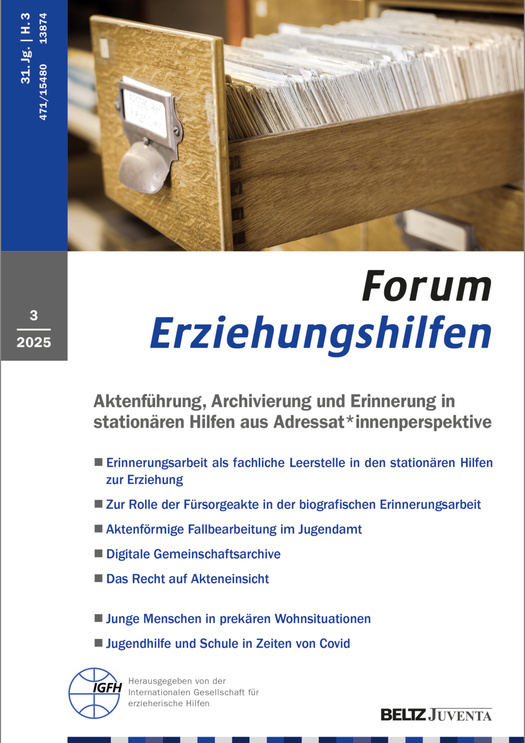
Akten und andere Formen der Dokumentation werden im deutschsprachigen Kontext zumeist in dem Bewusstsein erstellt, aufbewahrt und oftmals auch wieder vernichtet, da es sich um Materialsammlungen für Behörden, Organisationen und Professionen handelt. Befunde aus Studien, Stimmen von Careleaver*innen, internationale Debatten und aktuelle Entwicklungen verdeutlichen allerdings, dass diese Sicht im Kontext stationärer Erziehungshilfen verkürzt ist. So ist gut dokumentiert, dass aktenförmige Materialsammlungen gerade für Careleaver*innen eine bedeutsame Quelle sein können, insbesondere um sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen und sich an die eigene Vergangenheit zu erinnern, wenngleich (ehemalige) Adressat*innen gegenüber der bisherigen Praxis der Aktenführung und -archivierung auch seit geraumer Zeit diverse Kritiken formulieren. Während deshalb etwa in Großbritannien seit Jahren eine umfangreiche Diskussion geführt wird, wie Akten im Sinne der sie betreffenden Kinder und Jugendlichen erstellt, archiviert und im späteren Leben für sie zugänglich gemacht werden können, findet eine derart adressat*innenorientierte Auseinandersetzung in Deutschland kaum statt. Gerade angesichts des aktuell wachsenden Bewusstseins um die Situation von Careleaver*innen ist dies verwunderlich, ist doch ein Recht auf Kenntnis der eigenen Geschichte mit Möglichkeiten des Erinnerns grundlegend für eine menschliche Biografie.
Einen wichtigen Impuls für einen veränderten Umgang mit Akten und Dokumentationen könnte hierzulande der 2026 in Kraft tretende Aufarbeitungsparagraf „9b“ ins SGB VIII darstellen. Zwar werden die damit einhergehenden erweiterten Akteneinsichtsrechte für (ehemalige) Adressat*innen und -aufbewahrungspflichten für Träger der Kinder- und Jugendhilfe argumentativ nicht mit dem Erinnerungsbedarf von Careleaver*innen verknüpft. Gleichzeitig könnte und sollte spätestens dies zum Anlass genommen werden, die hiesige Fachdebatte über Akten, Archivierung und Erinnerung deutlich zu intensivieren sowie sich fachlich von adressat*innenorientierten Überlegungen stärker leiten zu lassen. Der Themenschwerpunkt dieses Heftes möchte hierzu Anregungen geben. Versammelt werden Beiträge aus Deutschland, Österreich und Schottland, die sich mit unterschiedlichen Fragen im Kontext des Erinnerns an stationäre Erziehungshilfen diesseits und jenseits von Akten auseinandersetzen.
Der einführende Beitrag von Florian Eßer und Maximilian Schäfer geht zunächst der Frage nach, welche Rolle Erinnerungsstützen für die Entwicklung des biografischen Selbst von (jungen) Menschen spielen und wie es mit den Möglichkeiten des Erinnerns für Careleaver*innen momentan bestellt ist.
Michaela Ralser, Ulrich Leitner und Flavia Guerrini zeichnen an einem konkreten Fallbeispiel aus Österreich nach, wie Menschen mit Heimerfahrung auch stigmatisierende und verletzende historische Fürsorgeakten als Erinnerungsstütze und Ressource für die eigene Biografiearbeit nutzen können.
Daniela Molnar setzt sich sowohl theoretisch als auch empirisch mit der Frage auseinander, wie sich sozialpädagogische Fallarbeit in und durch Jugendamtsakten dokumentiert – wobei sie zu ernüchternden Ergebnissen hinsichtlich der sich in den Akten zeigenden Professionalität der Fachkräfte kommt.
Tanja Abou beschäftigt sich aus autobiografischer Perspektive mit dem bislang nur unzureichend berücksichtigten Erinnerungsbedarf von (ehemaligen) Adressat*innen der stationären Erziehungshilfen. Sie fordert eine zu intensivierende Praxis des Erinnerns an Bezugspersonen, Erlebnisse und gemeinsame Geschichte(n) in stationären Hilfen.
Auf der Grundlage einer breiten Diskussion um eine angemessene Aktenführung und eines in Schottland recht ausgeprägten Fachbewusstseins für die Erinnerungsbedarfe von Careleaver*innen referieren Ruth Emond und Andrew Burns schließlich ausgewählte Ergebnisse eines deutsch-schottischen Verbundprojektes. In diesem wurden digitale Gemeinschaftsarchive für und mit Wohngruppen entwickelt, um kollektive Erinnerungsräume jenseits individualisierter Fallakten zu eröffnen.
Eine kurze Notiz von Peter Schruth informiert Schutzinstrumente und Einsichtsrechte für (ehemalige) junge Menschen im Kontext des Runden Tisches Heimerziehung.
Florian Eßer, Maximilian Schäfer